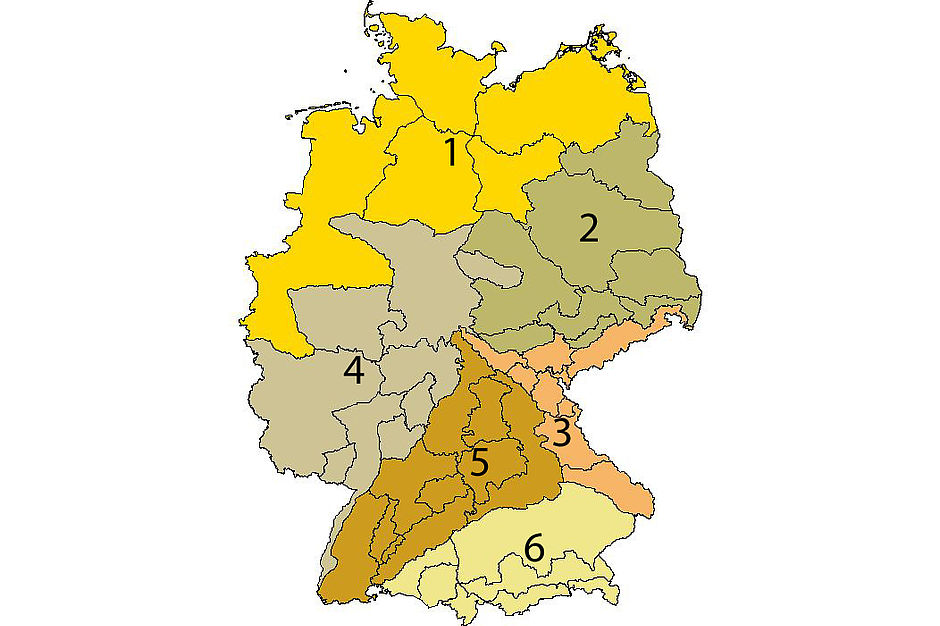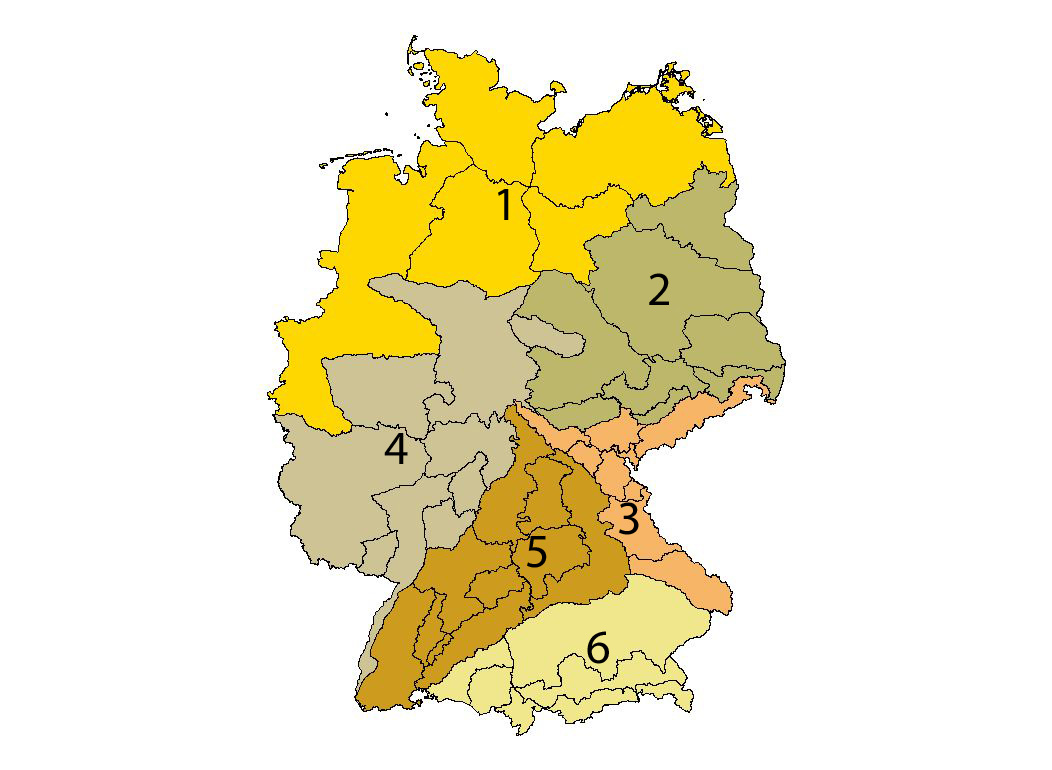Spagat zwischen Wirtschaft und Naturschutz
Es stellte sich schnell heraus, dass der Spagat zwischen den wirtschaftlichen Gegebenheiten und den naturschutzrechtlichen Ansprüchen der Länder und des Bundes nicht leicht zu vollführen ist. Insbesondere kam zur Sprache, dass ausschreibende Stellen kaum unterscheiden können, wie glaubwürdig die Herkunftsnachweise der Gehölze sind. Es wurde deutlich, dass die Ausstellung von Einzelnachweisen und Gutachten von Sachverständigen immer wieder an der Tagesordnung sind. Dies kritisierten die Baumschulvertreter und mahnten die Vertreter der Behörden an, eine intensive Informationskampagne bei den ausschreibenden Stellen vorzunehmen, um solche Fälle auszuschließen. Die Mindestanforderungen des Leitfadens für gebietseigene Gehölze schließen solche Einzelnachweise klar aus. Die Erzeuger- und Zertifizierungsgemeinschaften sehen ihre Standards durch solche Praktiken gefährdet und den eigenen Ruf in Mitleidenschaft gezogen.
BdB mahnt Ausweisung von Saatgutbeständen an
Ein wesentliches Problem ist nach wie vor die Ausweisung von Saatgutbeständen. Auch hier sind einige Länder nach wie vor zu passiv, obwohl die Vertreter des BdB seit sechs Jahren eine diesbezügliche Bewegung anmahnen. Bereits 2012 hatte der Verband dies gegenüber der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) verdeutlicht.
Einigung
Die Runde aus Bund, Ländern und Zertifizierungsgemeinschaften war sich einig, die Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener Gehölze nicht zu verschärfen. Zur besseren Abgrenzung gegenüber falschen Nachweisen, soll die bereits heute notwendige Akkreditierung der Zertifizierungsgesellschaften bei der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) in einem sogenannten Scope "gebietseigene Gehölze" spezifiziert werden. Das bedeutet, dass die bisherigen bundesweiten Empfehlungen der Arbeitsgruppe "gebietseigene Gehölze" in Bezug auf die Mindestanforderungen deutschlandweit bindend vorgeschrieben werden.
(gu)